Albert Memmi
Die Salzsäule
Dieses Buch hat mich zutiefst berührt; nicht nur, weil es teilweise an Orten spielt, die ich als Studentin täglich durchquerte, sondern auch, weil die beschriebene koloniale Realität viele Facetten meiner eigenen Lebensumstände Jahrzehnte später widerspiegelte. Der Roman erzählt von der Gewalt des Predigens einer universellen Welt der Menschenrechte, die jedoch bestehende Machtstrukturen nicht benennt. Er beschreibt die Zerrissenheit und das Schamgefühl, die durch strukturelle Unterordnung und Andersmachung entstehen. Dieser Roman gab mir die ersten Worte, um Dinge zu benennen, die zuvor namenlos geblieben waren. Seitdem weiß ich um die Kraft des Benennens.
Identitätssuche in kolonialen Strukturen
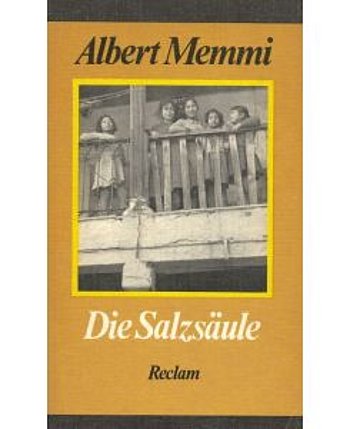
Die Salzsäule (La statue de sel) ist ein autofiktionaler Roman, der stark von Albert Memmis eigener Biografie inspiriert ist. Der Protagonist, Alexandre Mordekhaï Benillouche, wächst in der jüdischen Gemeinschaft Tunesiens während der französischen Kolonialherrschaft auf. Nach einer Kindheit, die gleichermaßen von Armut und familiärer Geborgenheit geprägt ist, begibt sich Mordekhaï auf eine Identitätssuche voller Ambivalenzen, Zerrissenheit und Scham.
Die Geschichte schildert eindrücklich die Spannungen zwischen Emanzipation durch Bildung und der erlebten Gewalt als Kolonisierter. Mordekhaï erkennt, dass die „großen Denker der Aufklärung“ zwar über Menschenrechte schreiben, diese jedoch für ihn nicht gelten. Die Kolonialmacht legitimiert ihre Gewalt, indem sie sie mit dem Versprechen der Zivilisation überdeckt.
Memmi schrieb diesen Roman, um Ordnung in seine eigene Geschichte zu bringen, sagt er. Er ist ein persönliches Zeugnis und zugleich eine tiefgehende Reflexion über Identität, Sprache und Macht in (post)kolonialen Kontexten.
Albert Memmi: Zwischen Gefühl und Analyse

Albert Memmi (1920–2020) war ein tunesisch-französischer Schriftsteller und Soziologe, dessen Werke die koloniale Erfahrung aus der Perspektive eines jüdisch-tunesischen Intellektuellen beleuchten. In seinem späteren Essay “Der Kolonisator und der Kolonisierte” analysiert er die soziologischen Mechanismen des Kolonialismus.
“Die Salzsäule” und “Der Kolonisator und der Kolonisierte” sind zwei sich ergänzende Werke, die koloniale Realitäten erfassen; nicht durch eine künstliche Trennung von Theorie und Biografie, sondern durch eine enge Verzahnung von persönlichem Erleben und analytischer Reflexion. Beide Bücher sind Formen von Wissen: Die Salzsäule vermittelt die Erfahrung des Kolonisierten in literarischer Verdichtung, während der Essay diese Erfahrung als Ausgangspunkt nimmt, um koloniale Machtverhältnisse als strukturelles Phänomen zu begreifen.
Eine literarische Annäherung an koloniale Machtverhältnisse und Identität
Wer internationale Zusammenarbeit durch die Linse historischer Machtverhältnisse verstehen will, findet hier eine literarische Annäherung an zentrale Fragen: Wie wirken sich (post)koloniale Strukturen auf das Selbstbild von Individuen aus? Wie prägt Sprache den Blick auf sich selbst und die Welt? “Die Salzsäule” ist eine wunderschön geschriebene Geschichte der Zerrissenheit und Identitätssuche, in der Albert Memmi sich der Komplexität seiner Realität stellt. Sie verschafft uns einen tiefen Zugang zu den Gedanken eines Zeitzeugen.
“Die Salzsäule”, Roman, Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin 1963, 1. Aufl. (deutsche Erstausgabe, Übersetzung Gerhard M. Neumann, französisches Original: La Statue de sel, 1953)
Weitere Ausgaben: Reclam, Leipzig 1978. Nur noch antiquarisch erhältlich.
Zum Weiterlesen
“Der Kolonisator und der Kolonisierte: zwei Porträts.” Mit einem Vorw. von Jean-Paul Sartre und einem Nachwort des Autors zur deutschen Ausgabe, übersetzt von Udo Rennert, Syndikat Verlag, Frankfurt/M. 1980 (französisches Original: Portrait du colonisé. Précédé du Portrait du colonisateur, Buchet/Chastel, Paris 1957)
Lizenzhinweis:
Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-4.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Memmi_par_Claude_Truong-Ngoc_décembre_1982.jpg), „Albert Memmi par Claude Truong-Ngoc décembre 1982“, creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
